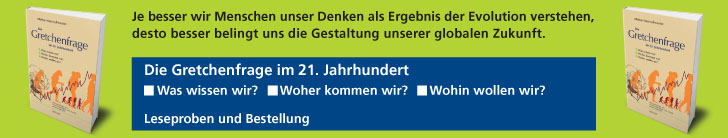Wissenschaft und Forschung
Unterschätzte Ungleichheit
Obwohl die sozialen Unterschiede zunehmen, formiert sich in demokratischen Staaten kein breites Bündnis für mehr Umverteilung. Wissenschaftler*innen untersuchen die Gründe dafür und sie erforschen dabei auch, wie Zuwanderung und Armut die Haltung gegenüber staatlichen Eingriffen beeinflussen.
Obwohl die sozialen Unterschiede zunehmen, formiert sich in demokratischen Staaten kein breites Bündnis für mehr Umverteilung. Wissenschaftler*innen untersuchen die Gründe dafür und sie erforschen dabei auch, wie Zuwanderung und Armut die Haltung gegenüber staatlichen Eingriffen beeinflussen.
Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich, und zwar schon seit Langem. Über das gesamte 20. Jahrhundert hinweg lässt sich in allen Industrieländern der gleiche Verlauf beobachten: Die Einkommen der Reichen und Reichsten – und deren Anteil am gesamten Volkseinkommen – haben schon in der Zeit vor dem ersten Weltkrieg Spitzenwerte erreicht. Auf die beiden Weltkriege folgte eine Phase der Angleichung. Doch schon bald begannen die Top-Verdienste, quasi den Schwung der Talfahrt nutzend, stetig wieder anzusteigen, um sich den Verhältnissen im frühen 20. Jahrhundert wieder anzupassen. Heute gehören den reichsten zehn Prozent der Deutschen 67 Prozent des Vermögens im Land. Mehr als die Hälfte davon – nämlich 35 Prozent des Gesamtvermögens – ist in der Hand von nur einem Prozent der Bevölkerung. Die ärmeren fünfzig Prozent der Deutschen hingegen verfügen nur über 1,4 Prozent des gesamten Vermögens.

Die Verteilung der Nettovermögen – also des Vermögens nach Abzug der Schulden – ist in Deutschland weit ungleicher als bisher angenommen. Das ergab eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Juli 2020. © GCO nach dem Sozio-ökonomischen Panel, DIW
Wie sind solche Zustände in einer Demokratie möglich? Sollte man nicht meinen, dass sich die weniger wohlhabende Mehrheit zusammentut, um den Reichen höhere Steuern abzuverlangen und die öffentlichen Gelder verstärkt an diejenigen auszuschütten, die in Sachen Verteilung auf der Verliererseite stehen?
Eine Mehrheit gegen die Erbschaftssteuer
Eine Erklärung dafür, dass auch eine funktionierende Demokratie kein Garant gegen Ungleichheit in Sachen Einkommen und Vermögen darstellt, nennt Lisa Windsteiger, Ökonomin am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, die „Nachfrage nach Ungleichheit“. Wissen und Nichtwissen ist ein Aspekt, der hier eine Rolle spielt. Ein Beispiel: Jüngeren Umfragen zufolge halten etwa siebzig Prozent der Deutschen die (hierzulande eher gering ausfallende) Erbschaftssteuer generell für unfair. Tatsächlich aber ist, wenn man von zwei Erben je Steuerfall ausgeht, nur eine von dreizehn Erbschaften überhaupt steuerpflichtig. Das bedeutet: Die überwiegende Mehrheit der Deutschen wird durch die Erbschaftssteuer nicht benachteiligt. Dennoch findet sich für eine Reform der Erbschaftsteuer, bei der insbesondere wohlhabende Erben deutlich stärker zur Kasse gebeten würden, keine politische Mehrheit.
Mehr als Wissen und Nichtwissen interessiert Lisa Windsteiger, wie Menschen reagieren, wenn sie mit bestimmten Themen konfrontiert werden. „Wir gehen davon aus, dass die Präferenzen oder die Werteinstellungen der Menschen im Wesentlichen stabil sind und sich nicht situativ verändern. Allerdings passen Menschen unter bestimmten Umständen ihr Verhalten an – sie stimmen in Bezug auf Umverteilung anderen Aussagen zu als sonst und lehnen andere Aussagen ab, wenn bestimmte Themen in den Fokus ihrer Aufmerksamkeit geraten. Das beschreiben wir als ‚Nachfrage‘.“
Diese Nachfrage nach Umverteilung erforscht Lisa Windsteiger in Umfrageexperimenten, oftmals gemeinsam mit ihrem Kollegen Andrea Martinangeli. „In den Experimenten präsentieren wir Probanden gezielt bestimmte Themen“, erklärt Windsteiger. „Wir zeigen zum Beispiel kleine Videos, in denen bereits bekannte Sachverhalte einfach nur angeteasert werden – etwa Immigration oder Armut.“ Ihre Hypothese ist: Der Effekt, der sich beobachten lässt, wenn wir im Experiment bereits bekannte Themen austesten, ist ein Indikator für die Wirkung, welche eine in der Medienöffentlichkeit vorherrschende Themenagenda innerhalb eines längeren Zeitfensters auf Bürgerinnen und Bürger ausübt.
Der Einfluss sozialer Abschottung
Durchgeführt werden die Experimente über eine Online-Plattform. Zwei- bis viertausend Testpersonen werden jeweils eingeladen. Schritt für Schritt testet Lisa Windsteiger dabei verschiedene, zum Teil aufeinander aufbauende Hypothesen aus, für die sie meistens im Vorfeld bereits ein mathematisches Modell entwickelt hat. Welchen Einfluss hat soziale Abschottung – also das sich Bewegen in Blasen von sozial ähnlich gestellten Menschen – auf Ansichten zum Thema Umverteilung? Welchen Effekt hat der Grad von Homogenität in diesen Blasen? Wie verändert es die Nachfrage nach Umverteilung, wenn Menschen sich Themen wie Zuwanderung oder Armut vor Augen führen? Neben Umfragen kommen in den Studien auch Laborexperimente zum Einsatz, wo eine kleinere Zahl von Teilnehmenden – meist Studierende – am Computer in den Münchner Institutsräumen Situationen durchspielen, in denen es vor allem um Interaktion geht. Windsteiger: „In so einem Setting kann man zum Beispiel gut erforschen, wie sich Erwartungen an das Gegenüber in bestimmten Situationen verändern.“
Abschottung zum Beispiel: Steigende Ungleichheit geht oftmals einher mit einer ebenfalls stärker werden sozioökonomischen Abschottung, der sogenannten Segregation, was sich insbesondere in der Gentrifizierung von Stadtquartieren bemerkbar macht. Um herauszufinden, was hier Ursache und was Folge ist, wurde ein Umfrageexperiment durchgeführt. Die zugrunde liegenden (und in einem mathematischen Modell dargelegten) Hypothesen waren: Menschen schätzen falsch ein, wo in der Vermögens- und Einkommensskala sie selbst sich bewegen und haben folglich auch ein verzerrtes Bild davon, inwiefern andere über drastisch mehr oder weniger Ressourcen verfügen. Und: Der Grad an Homogenität, der in den Blasen herrscht, verstärkt diese Verzerrungen.

Spaltung in Arm und Reich: Das Beispiel Chicago zeigt, wie sich Menschen zunehmend nach ihren Einkommensverhältnissen in bestimmten Wohngegenden sammeln. Das fördert die Bildung sozialer Blasen. © GCO nach Daniel Hertz
Im Umfrageexperiment zeigte sich: Je höher das eigene Einkommen ist, desto höher ist auch das vermutete Durchschnittseinkommen. Menschen mit niedrigerem Einkommen unterschätzten das Durchschnittseinkommen in der Bevölkerung, relativ betrachtet, stärker. Dementsprechend liegt vermutlich auch ihre Erwartung an persönliche Zugewinne, die durch soziale Umverteilung erzielt werden könnten, niedriger als diese tatsächlich ausfallen könnten. Außerdem, so zeigt das Experiment, wird das Einkommen der anderen (und somit die eigene Positionierung auf der Einkommensskala) desto verzerrter wahrgenommen, je stärker die eigene soziale Abschottung ist. Auch dieser Effekt legt nahe: Soziale Blasen haben den Effekt, dass Menschen, die relativ betrachtet weniger verdienen, den Abstand unterschätzen, der sie von den Wohlhabenden trennt. Dementsprechend gering fallen vermutlich die Erwartungen hinsichtlich erzielbarer Zugewinne durch eine Umverteilung aus.
Gegensätzliche Reaktionen auf Reizthemen
Ein weiterer Themenkomplex: Zuwanderung und Armut. Hier gab es gleich verschiedene Ausgangshypothesen. Eine Hypothese besagt: Ein größeres Maß an ethnischer Diversität, hervorgerufen durch eine verstärkte Zuwanderung, bewegt die Nicht-Zugewanderten dazu, Programmen der Umverteilung und der Unterstützung für sozial Bedürftige ihre Unterstützung zu entziehen. Der Grund: Die Immer-schon-da-gewesenen vermuten, dass die Zugewanderten– zu denen sie selbst keine große soziale Nähe verspüren – den größten Profit von den Leistungen haben.
Eine andere Hypothese besagt: Die Zuwanderung wird von Bevölkerungsgruppen, die selbst im Niedriglohnbereich arbeiten, zwar als Konkurrenz wahrgenommen. Trotzdem befürworten sie Umverteilung, weil sie durch die Konkurrenz in die Situation kommen könnten, dass sie selbst soziale Unterstützung brauchen. Arbeitnehmer mit höherem Einkommen hingegen entziehen solchen Programmen eher die Unterstützung, weil sie als Nettoeinzahler ins Sozialsystem befürchten, dass ihre Belastung steigt.
In den Resultaten der Umfrageexperimente modifiziert sich dieses Bild. Niedrigere Einkommensgruppen reagieren, mit dem Thema Zuwanderung konfrontiert, tatsächlich damit, dass ihre Nachfrage nach einer (progressiven) Steuererhöhung steigt, während mittlere Einkommen unter den gleichen Bedingungen ihre Nachfrage reduzieren. Hohe Einkommen zeigen keine Reaktion. Mit dem Thema Armut konfrontiert, zeigt sich in keiner Gruppe eine Veränderung der Nachfrage nach progressiven Steuererhöhungen. Das Thema Armut hat aber, insgesamt betrachtet, einen positiven Effekt auf einen anderen Faktor: die Nachfrage nach öffentlichen Bildungsausgaben. Im Detail zeigt sich jedoch, dass dieser Effekt allein durch das Verhalten der mittleren Einkommensgruppen bedingt ist. Dagegen entziehen Niedrigeinkommen öffentlichen Bildungsausgaben ihre Zustimmung, wenn man sie mit dem Thema Zuwanderung konfrontiert.
Eine eindeutige Politikberatung lässt sich aus diesen Beobachtungen schwerlich ableiten. Vielmehr zeigen die Resultate, wie verzwickt die Sachlage ist. Sollte eine Partei, die gesellschaftliche Umverteilung im Programm führt, Armut oder Zuwanderung eher offen thematisieren oder nicht? „Unsere Resultate“, meint Lisa Windsteiger, „zeigen, dass es bei verschiedenen Gruppen von Wählern sehr unterschiedliche, oft sogar entgegengesetzte Reaktionen auf Themenbotschaften gibt.“ Das bedeutet nicht, dass strategisches Themenmanagement unmöglich wäre. „Man muss tatsächlich die einzelnen Effekte sehr genau kennen, um Voraussagen darüber zu machen, wie sich diese insgesamt auswirken.“ Dazu legen die Verhaltensexperimente am Münchner Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen den Grundstein.
Simulierter Matthäus-Effekt
Als ökonomische Ursachen für die steigende Ungleichheit gelten die Globalisierung und der technische Wandel, vor allem aber der Matthäus-Effekt. Gemeint ist, dass Reiche immer Reicher werden, frei nach dem Bibelzitat „Wer hat, dem wird gegeben“. Zu den nichtökonomischen Ursachen für wachsende Ungleichheit zählen eingeschränkte Mobilität auf den Arbeitsmärkten, sich abschottende Eliten und in Bezug auf Einkommen Eigendynamiken von Vergütungspraktiken insbesondere im höheren Management.
Welche Rolle die Politik dabei spielt, ist umstritten. In so gut wie allen Industrienationen ist es zu einem Anstieg der Ungleichheit gekommen, nicht nachdem, sondern bevor konservative Regierungen an die Macht gekommen waren und begonnen hatten, Umverteilung zu reduzieren. Für eine eher nicht so dominante Rolle der Politik spricht noch etwas anderes: Marco Serena, wie Lisa Windsteiger Reasearch Fellow am Münchner Max-Planck-Institut, hat sich in einer spieltheoretischen Simulation damit befasst, wie Ungleichheit Wahlen beeinflussen kann. Dabei ist er zu dem erstaunlichen Ergebnis gekommen, dass nicht etwa ein größerer Prozentsatz an finanziell benachteiligten Bürgern zu einer Wahlentscheidung zugunsten stärkerer Umverteilung führt. Im Gegenteil: Wenn die Gruppe der Benachteiligten eine bestimmte Größe überschreitet, tendieren die Wahlergebnisse eher in Richtung weniger Umverteilung.

Andrea Martinangeli, Lisa Windsteiger und Marco Serena (von links) forschen am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und öffentliche Finanzen zu Fragen sozialer Ungleichheit. Foto: © Stefanie Aumiller
Der Effekt lässt sich am besten anhand eines stark vereinfachten Beispiels erklären. Peter, Marie und Sabine sind unterschiedlich vermögend. Während Sabine vier Goldstücke besitzt, haben Peter und Marie jeweils nur eines. Es findet eine Wahl statt, in der über eine gesellschaftliche Umverteilung entschieden wird. Bei einem Patt entscheidet der Münzwurf. Jeder der drei überlegt nun für sich, ob es den Aufwand wert ist, an einem Sonntag Zeit zu opfern, um ins Wahllokal zu gehen. Dabei entspinnt sich ein kompliziertes Netz von gegenseitigen Erwartungen und möglichen Situationen. Gehen alle drei zur Wahl, haben Peter und Marie die Mehrheit und können die Umverteilung durchsetzen. Als Folge der Umverteilung würde jeder der drei über zwei Goldstücke verfügen. Das hieße: Sabine verliert zwei Goldstücke, Peter und Marie gewinnen jeweils ein Goldstück. Peter und Marie denken sich: Aufgrund dieses wahrscheinlichen Ausganges wird Sabine vielleicht gar nicht zur Wahl erscheinen – auch wenn sie mehr zu verlieren hat, als Peter und Marie jeweils gewinnen können. In diesem Fall würde es dann aber auch reichen, wenn nur einer der beiden – Peter oder Marie – zu Wahl geht, damit die beiden je ein Goldstück erhalten. Das Problem ist: Wenn beide so denken und keiner zur Wahl geht, findet keine Umverteilung statt. Außerdem könnte Sabine die strategischen Überlegungen von Peter und Marie antizipieren und deshalb selbst ganz sicher zur Wahl gehen.
Faustregel für kleine Gruppen
Schon das einfache Beispiel mit nur drei Personen zeigt, dass es gar nicht so trivial ist, mögliche Szenarien korrekt zu erfassen, die wiederum einen Effekt auf gegenseitige Verhaltenserwartungen und somit auf die Wahlbeteiligung ausüben. In dem Modell, das Marco Serena entwickelt hat, lässt sich nun exakt verfolgen, welchen Effekt die Gruppengröße und die Differenz im Besitz auf den Wahlausgang haben. „Mathematisch am schwierigsten war die Darstellung des asymmetrischen Nutzens“ erklärt Serena. „Dies führt dazu, dass es mehrere Kipppunkte gibt, an denen die Situation sich zum Vorteil der Habenden oder der Nicht-Habenden wandelt.“
Seine Neuerung: „Es ist tatsächlich das erste Modell, welches mathematisch vorhersagen kann, unter welchen Bedingungen in einer ungleichen Gruppe diejenigen Wähler, die zu den Habenichtsen gehören, aber in der Mehrheit sind, keinen Anreiz haben, zur Wahl zu gehen“ fasst Serena zusammen. In Bezug auf die Realität bildet das Modell Vorgänge bei der Wahl in relativ kleinen Gruppen nach, die nach dem Mehrheitswahlrecht verfahren, wie etwa in einem Aufsichtsrat. Der Grund: Nur in diesen kleineren Gruppen können Wähelnde überhaupt erwarten, dass ihre Stimme einen Unterschied macht. „Bei einer kommunalen oder einer nationalen Wahl gehen die Leute eher deshalb zur Urne, weil sie sich dazu moralisch verpflichtet fühlen oder weil sie ihren politischen Überzeugungen irgendwie Ausdruck verleihen wollen“, meint Serena. Ein konkreter Erwartungsnutzen lässt sich hier nicht einmal in der Theorie kalkulieren.
Für kleinere Gruppen aber lässt sich als Faustregel aus dem von Serena entwickelten Modell ableiten: Eine Umverteilung findet nur dann statt, wenn die Zahl der Habenichtse kleiner ist als die Zahl der Reichen zum Quadrat. Leben in einem Dorf also zehn Reiche und weniger als hundert Habenichtse, stehen die Chancen gut, dass der Bürgermeister die Steuereinnahmen umverteilen darf. Sind es genau hundert Habenichtse oder mehr, findet keine Umverteilung statt.
Serenas Resümee des methodischen Ansatzes gilt wohl auch für die Arbeiten der beiden anderen Forschenden: „Wir greifen einen einzelnen Effekt heraus, von dem es plausibel ist, dass er im Gesamtgeschehen eine Rolle spielt. Wir sagen nicht, dass es keine anderen Effekte gibt. Aber wenn wir Modelle hätten für die Gesamtheit der Effekte, die eine Situation beeinflussen, dann könnten wir ein Gesamtmodell erstellen, mit dem man sehr weitreichende Prognosen erzielen würde.“
Text: Ralf Grötker (mpg)