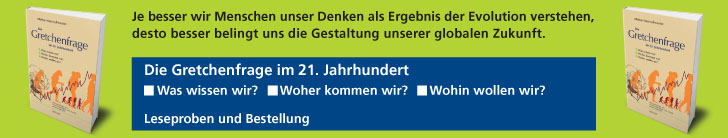Essay & Diskurs
Die ambivalente Wirkmacht der Worte
Die Hoffnung ist alt – und ganz aktuell: Kommunikation, der Austausch von Argumenten, möge Konflikte lösen und Gewalt vermeiden. Was aber, wenn Sprache Verhältnisse nicht nur beschreibt, sondern überhaupt erst herstellt? Wie umgehen mit Verschwörungserzählungen und Hassrede? Poststrukturalistische, feministische und postkoloniale Theorien bringen eine Grundannahme der Demokratietheorie ins Wanken.
Warum wir über Sprache sprechen sollten
Von Vanessa Wintermantel, Berlin
In der liberalen politischen Theorie wie auch im Alltagsverständnis gilt Sprache als gewaltfreies Mittel. Erst am Ende der guten Argumente, so die allgemeine Auffassung, steht die stumme Gewalt. Die Sprache wird als befreiende und selbstermächtigende Kraft verstanden, die darüber hinaus die Kommunikation mit anderen ermöglicht. Liberale Demokratien beruhen daher auf der Institutionalisierung des verbalen Austauschs politischer Ideen in Parlamenten (darin steckt bekanntlich das französische Verb „parler“, „reden“). Und Bürger*innen können ihre Stimme nutzen, um politische Entscheidungen durch Protest auf der Straße oder vor Gericht anzufechten. Aktuelle politische Debatten stellen diese rein positive Sicht auf die Sprache jedoch in Frage. Hassrede und die beharrliche Verwendung rassistischer und anderer diffamierender Personenbezeichnungen lassen Zweifel an der Vorstellung aufkommen, Sprache sei ein unschuldiges Mittel der gewaltfreien und rationalen Verständigung. Fake News und die folgenreiche Verbreitung von Verschwörungserzählungen tun ihr Übriges dazu. Diese Phänomene lassen erahnen, dass die Wirkmacht der Sprache ambivalent ist: Sie befreit, klärt auf und ermöglicht Austausch und Einigung mit anderen, aber sie kann auch unterdrücken, verletzen, verschleiern und nötigen. Diese Sichtweise auf die Sprache wurde vom Poststrukturalismus geprägt und beeinflusst viele feministische und postkoloniale Theorien. Sie stellt Demokratietheorien, die zur Legitimierung politischer Entscheidungen auf die Sprache zählen, vor die Herausforderung, eine ihrer Grundannahmen neu zu bewerten.
Ein häufig genanntes Beispiel für das klassische liberale Verständnis von Sprache ist John Stuart Mills „Über die Freiheit“. Mill gilt, je nach Sichtweise, entweder als einer der größten Verteidiger der Redefreiheit oder als Vordenker einer radikal fundamentalistischen Deutung, der zufolge der freien Rede bis hin zur Volksverhetzung keine Schranken gesetzt werden sollten.
„Die freie Rede kann die Tyrannei verhindern“
Mill sieht in der Sprache die mächtigste Waffe gegen die Bedrohung durch eine „tyrannische Mehrheit“, die ihren Willen als allgemeinen Volkswillen inszeniert und keinen Raum für abweichende Meinungen lässt. Eine solche Tyrannei der Mehrheit hält er für nicht weniger gefährlich als eine despotische Alleinherrschaft. Darüber hinaus versteht Mill die Sprache als ein wichtiges Instrument zur Wahrheitsfindung. Somit ist die freie Rede für ihn kein reiner Selbstzweck: Es geht ihm nicht darum, die Meinungsvielfalt im öffentlichen Raum zu fördern und zu erhalten, denn deren Grenzen verengten sich mit dem Fortschritt der Menschheit zwangsläufig. Vielmehr ist Mill davon überzeugt, dass die freie Rede nicht nur die Tyrannei verhindern kann, sondern auch den objektivierbaren Wissensbestand über die Welt erweitert und damit der Menschheit einen unermesslichen Nutzen bringt.
Auch zeitgenössische Theorien der Demokratie teilen diese positive Sichtweise auf die Sprache: Sie gilt ihnen als Instrument zur kollektiven und möglichst konsensualen Entscheidungsfindung. So sieht etwa John Rawls in der freien Rede eine Bedingung für das Funktionieren eines demokratischen Systems und dafür, dass politische Entscheidungen in rationaler Weise getroffen werden. Mittelbar wird die möglichst uneingeschränkte Redefreiheit somit auch zur Voraussetzung für Rawls’ Konzeption der Gerechtigkeit und damit zur normativen Grundlage demokratischer Legitimität. Eine solche Vorstellung der Sprache als im Grunde rationale politische Kraft der intersubjektiven Verständigung ist auch für einflussreiche Denker*innen in der Tradition der Frankfurter Schule prägend. So formulierte etwa Jürgen Habermas Bedingungen an die Teilnehmenden eines Diskurses für eine „ideale Sprechsituation“ jenseits aller Machtstrukturen, in der nichts als „der zwanglose Zwang des besseren Arguments“ den Ausschlag für eine kollektive Entscheidung gebe.
„Sprache bildet die soziale Wirklichkeit nicht nur ab – sie erschafft sie“
Wie etwa die postkoloniale queerfeministische Theoretikerin Nikita Dhawan aufzeigt, wird das liberale Verständnis der Sprache von Theorien in strukturalistischer und poststrukturalistischer Tradition kritisiert. Diese stellen, vereinfacht gesagt, das Verhältnis zwischen Sprache und (sozialer) Wirklichkeit auf den Kopf: Während der Liberalismus die Sprache als Abbild der Realität und als Instrument zur Verständigung und Wahrheitsfindung versteht, ist die Sprache im poststrukturalistischen Verständnis die Kraft, die die soziale Realität konstituiert und bestimmt. Um dies zu veranschaulichen, weisen Chantal Mouffe und Ernesto Laclau darauf hin, dass die soziale Realität eines Ereignisses, wie etwa die eines Erdbebens, von seiner diskursiven Konstruktion abhängt: Der soziale Diskurs bestimmt, ob es als Naturereignis oder als Strafe Gottes verstanden wird. Sprache bildet die soziale Wirklichkeit also nicht nur ab – sie erschafft sie. Natürlich gilt das nicht nur für Naturereignisse: Der gesellschaftliche Diskurs wirkt in poststrukturalistischer Sichtweise ganz allgemein als normierende Kraft, die Wissensbestände, Unterscheidungen und Kategorisierungen, soziale Normen und Konventionen, Regeln und Praktiken festlegt und aufrechterhält – und dabei durchaus auch gewaltvolle Effekte entfaltet.
Ausgehend von diesem Verständnis der Sprache widmet sich Judith Butler in „Haß spricht: Zur Politik des Performativen“ der Frage, was es bedeute, der Sprache die Fähigkeit zuzuschreiben, zu verletzen. Unsere Verletzlichkeit gegenüber Worten, so Butler, resultiere aus der Tatsache, dass der Mensch ein „sprachliches Wesen“ sei, dessen Existenz sich in der Sprache konstituiere. Butler zufolge wird das gesellschaftliche Sein eines Körpers erst dadurch möglich, dass er angesprochen wird. Wir seien also auf die Ansprache angewiesen, um selbst zum Handlungssubjekt zu werden. Gerade diese Abhängigkeit von der Sprache für die Annahme der eigenen Identität mache den Menschen also anfällig dafür, durch sie verletzt zu werden. Die Erfahrung, verletzend beschimpft zu werden, kann daher nach Butler buchstäblich „Gesten gestalten und das Rückgrat beugen“. Butler befasst sich auch mit den Bedingungen, die eine Äußerung als Hassrede qualifizieren. So sei ein Begriff vor allem dann verletzend, wenn ihm eine Geschichte der Unterwerfung anhafte, die durch seine Wiederholung „reinszeniert“ wird. Hassrede verletzt also, weil sie ein früheres gesellschaftliches Trauma der Verkennung und Unterwerfung zitiert, wieder hervorruft und verfestigt. Dies gilt insbesondere für rassistische, sexistische, queerfeindliche oder ableistische – also Menschen auf Grund ihrer Behinderung diskriminierende – Bezeichnungen.
Judith Butler führt die menschliche Verletzlichkeit gegenüber der Sprache also darauf zurück, dass die Subjektwerdung einer Person und ihre soziale Positionierung von der Sprache, oder genauer gesagt vom Diskurs, abhängt. Dass Sprache daher nicht nur in einzelnen Fällen von Beleidigungen oder Hassrede gewaltvoll sein kann, sondern ihr aufgrund ihrer Fähigkeit, andere zu unterwerfen, eine „originäre Gewalt“ innewohnt, bringt Nikita Dhawan auf den Punkt. Ihrem Verständnis nach liegt der Ursprung „diskursiver Gewalt“ darin, dass die Sprache durch „hegemoniale Anerkennungsnormen“ ganz grundsätzlich bedingt, ob und wie wir im sozialen Raum gelesen und unsere eigenen Äußerungen verstanden werden können. Somit ist die Sprache auch entscheidend dafür, wer sich als „legitime“ und „lesbare“ Teilnehmende an einem Diskurs beteiligen kann. Denn wie bereits eine der Begründer*innen der postkolonialen Theorie, Gayatri Chakravorty Spivak, in ihrem berühmten Essay „Can the Subaltern Speak?“ feststellte, produzieren hegemoniale Diskurse immer auch „Subalterne“, für die freie Rede schon allein deshalb keine gewaltfreie, rein emanzipatorische Kraft sein könne, weil es einen Konflikt gibt zwischen der Redefreiheit einer Person und der diskursiven Gewalt, die einer anderen durch deren Äußerung angetan wird. Die Redefreiheit einer Person beruhe somit immer „parasitär“ auf dem Schweigen der anderen.
Diese Überlegungen legen nahe, dass das liberale Verständnis der Sprache mindestens einseitig und unvollständig ist. Viele aktuelle politik- und rechtstheoretische Arbeiten befassen sich daher ganz praktisch mit der Frage, wie Hassrede eingedämmt werden kann. Manche Theoretiker*innen erwägen die Möglichkeit, bestimmte Begriffe zu verbieten oder Äußerungen zu zensieren. Andere, wie etwa Corey Brettschneider, betrachten die „Gegenrede“, bei der sich der Staat selbst in demokratischer Überzeugungsarbeit als Sprecher gegen diskriminierende Sprache oder Falschmeldungen engagiert, als geeignetere Strategie. Beide Ansätze setzen auf einen starken Staat bei der Bekämpfung von Hassrede.
Judith Butler sieht eine solche Stärkung des Staats kritisch und befasst sich stattdessen mit der Möglichkeit, sich hasserfüllte Begriffe anzueignen und ihnen so eine neue Bedeutung zu geben. Als Beispiel dient Butler dabei der Ausdruck „queer“, der in den 1980er-Jahren von der LGBTQIA+-Community positiv umgedeutet wurde. Eine solche Neubewertung sei möglich, so Butler, weil Begriffe keine für immer feststehende, reine Bedeutung haben. Zwar seien bestimmte Äußerungen, besonders im Falle der Hassrede, auf beinahe unerschütterliche Weise mit ihrem historischen Kontext verbunden, aber grundsätzlich könnten durch die „GegenAneignung“ eines Begriffs auch neue Kontexte für ihn erschlossen werden. Als weitere Strategie gegen diskursive Gewalt ergründet Nikita Dhawan die subversive Kraft des Schweigens. Strategisches Schweigen ist ihrer Ansicht nach besonders effektiv, weil es, anders als die demokratische Gegenrede, keine Bezugnahme auf den dominanten Diskurs erfordere und es daher vermeide, diesen zu verstärken und zu festigen. Außerdem geht Dhawan davon aus, dass Schweigen das Potenzial hat, Ungereimtheiten in dominanten Diskursen aufzudecken.
„Sprache wohnt aufgrund ihrer Fähigkeit, andere zu unterwerfen, eine originäre Gewalt inne“
Diese praktischen Fragen, die der Umgang mit Hassrede aufwirft, sind wichtig. Weitergedacht sind die Herausforderungen, die die poststrukturalistischen, feministischen und postkolonialen Sichtweisen auf die Sprache für Theorien der Demokratie bedeuten, aber noch viel tiefgreifender, als es die Frage nach dem Umgang mit Hassrede und Verschwörungserzählungen vermuten lässt. Denn wenn die Sprache nicht nur die wirksamste Waffe gegen Unterdrückung ist, sondern auch selbst eine Waffe der Unterdrückung, stellt sich die Frage, ob es ausreicht, den freien Diskurs zu institutionalisieren, um politische Entscheidungen zu legitimieren. Wenn Machtstrukturen ein Produkt der Sprache sind, dann erscheint eine ideale Sprechsituation, in der nur noch das gute Argument zählt, nicht nur in der Praxis unerreichbar, sondern bereits in der Theorie paradox. Wie gerecht also können politische Entscheidungen sein, die in vermeintlich freien Diskursen entstehen? Gewiss bleiben liberale Demokratien auf Sprache als Instrument zur Verständigung, Konfliktlösung und politischen Entscheidungsfindung angewiesen. Gerade deswegen sollte die Sprache aber nicht als gewaltfreies Instrument idealisiert, sondern ins Zentrum der Diskussionen um Gerechtigkeit, Repräsentation und gleiche Beteiligung gerückt werden.
Literatur
Butler, Judith: Haß spricht. Zur Politik des Performativen. Frankfurt am Main: Edition Suhrkamp 2006.
Dhawan, Nikita: Impossible Speech: On the Politics of Silence and Violence. Sankt Augustin: Academia Verlag 2007.
Dhawan, Nikita: „Hegemonic Listening and Subversive Silences: Ethical-political Imperatives“. In: Alice Lagaay/Michael Lorber (Hg.): Destruction in the Performative. Critical Studies Band 36. Amsterdam/New York: Rodopi 2012, S. 47-60.
Habermas, Jürgen: Theorie des kommunikativen Handelns. Band I. Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1995 [1981].
Laclau, Ernesto/Mouffe, Chantal: Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics. Second Edition. London/New York: Verso 2001 [1985].
Mill, John Stuart: On Liberty/Über die Freiheit. Ditzingen: Reclam 2009 [1859].
Rawls, John: A Theory of Justice. Revised Edition. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press 1999[1971].
Spivak, Gayatri Chakravorty: „Can the Subaltern Speak?“ In: Patrick Williams/Laura Chrisman (Hg.): Colonial Discourse and Post-colonial Theory. A Reader. New York: Columbia University Press 1994, S. 66-111