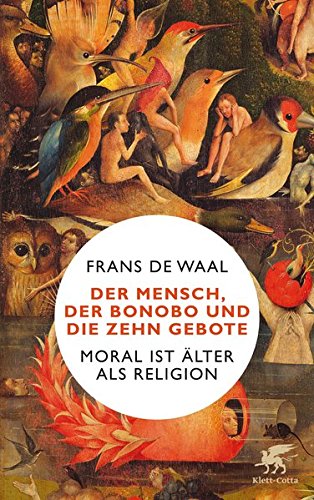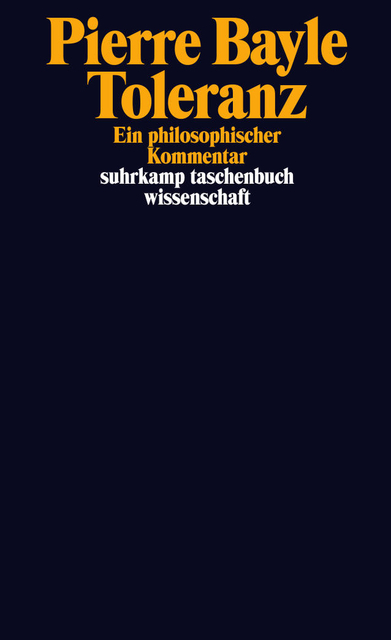Essay & Diskurs
Ist Monogamie moralisch falsch?
Die als ideale Form der Romantik gepriesene Monogamie wird von einer wachsenden Zahl von Philosoph*innen als unethisch bezeichnet.
Die als ideale Form der Romantik gepriesene Monogamie wird von einer wachsenden Zahl von Philosoph*innen als unethisch bezeichnet.

Foto: Mangostaniko / Wikimedia Commons / CC0
Von Brian D. Earp, Oxford
In den christlich geprägten Gesellschaften ist die Monogamie seit vielen Generationen die fast unangefochtene Spitzenreiterin der Beziehungsnormen. In Großbritannien und den USA wurde sie als das vorherrschende – eigentlich einzige – Ideal für ernsthafte romantische Partnerschaften hochgehalten, nach dem wir alle immer streben sollten. Laut den Autor*innen eines Artikels aus dem Jahr 2019 in Archives of Sexual Behavior, der sich auf den US-amerikanischen Kontext konzentriert, „umgibt monogame Beziehungen ein Heiligenschein … monogamen Menschen werden allein aufgrund der Tatsache, dass sie monogam sind, verschiedene positive Eigenschaften zugeschrieben.“ Andere Beziehungsmodelle oder auch nur die Tatsache, dauerhaft Single zu sein, wurden oft als anrüchig, wenn nicht gar als moralisch falsch angesehen.
Die Dinge beginnen sich jedoch zu ändern. Zumindest Progressive zeigen sich zunehmend aufgeschlossener gegenüber intimen Paarbeziehungen, von denen nicht erwartet wird, dass sie exklusiv sind. Es gibt ein wachsendes Bewusstsein für Alternativen zur Monogamie, wie z. B. die Polyamorie, d. h. die Wertschätzung oder das Eingehen von mehr als einer sexuellen oder romantischen Beziehung zur gleichen Zeit.
Monogamie als gesellschaftliche Norm
Die feministische Kritik an der obligatorischen Monogamie ist überzeugend. Lori Watson, Philosophieprofessorin an der Washington University in St. Louis, ist der Ansicht, dass „die Praxis und die Durchsetzung der Monogamie in Ehen weitgehend den Interessen der Männer gedient hat.“ Im Laufe der Geschichte wollten Männer sicherstellen, dass ihre Kinder auch wirklich die ihren sind: Auf diese Weise landet jeder Besitz, den sie vererben, bei ihren biologischen Nachkommen. Sie kommt zu dem Schluss, dass „die Vorstellung, dass dieses und nur dieses Arrangement respektvollen, liebevollen Beziehungen förderlich ist, kurzsichtig ist – und wohl dazu dient, die dominante Position, die Männer traditionell innehaben, zu stützen.“
Natürlich sind Männer in der heutigen Gesellschaft oft auch mit dem Stigma konfrontiert, dass sie nicht monogam leben können. Sie mögen beschuldigt werden, „Bindungsprobleme“ zu haben oder „nicht sesshaft zu werden“, wenn sie sich dem allgegenwärtigen Druck, eine*n „Seelenverwandte*n“ zu finden (und alle anderen zu meiden), widersetzen, egal wie überlegt oder absichtlich. Der Philosoph Justin Clardy argumentiert, dass heterosexuelle afroamerikanische Männer, die aus ethischen Gründen polyamor sind (mit dem Einverständnis aller Beteiligten), dennoch oft in schädlicher Weise als „Player“ stereotypisiert werden – also als Männer, von denen angenommen wird, dass sie „nur Sex wollen“.
Selbst Menschen, die sich als nicht-binär oder genderqueer identifizieren, sind gegen diese Art von Druck keineswegs immun. Wie die Mitglieder der homosexuellen Community, die Anfang der 2000er Jahre den Vorstoß für die gleichgeschlechtliche Ehe anführten, wissen sie, dass man mit einer monogamen Beziehung zumindest teilweise die Akzeptanz einer Gesellschaft gewinnen kann, die einen als „anders“ betrachtet. Historiker*innen werden uns daran erinnern, dass nicht jede*r in der homosexuellen Community mit der gleichgeschlechtlichen Ehe einverstanden war. Einige sahen darin eine bedauerliche Kapitulation vor allzu restriktiven Beziehungsnormen; ein unangemessener Preis für eine relativ respektvolle Behandlung durch die „heterosexuelle“ Gesellschaft.
Bis vor kurzem haben sich die Kritiker*innen der Monogamie jedoch nicht prinzipiell dagegen ausgesprochen. Sie haben vielmehr argumentiert, dass wir frei sein sollten, unsere Beziehungen nach unseren eigenen Vorlieben und Bedürfnissen zu gestalten. Solange alle Beteiligten erwachsen sind und dem Plan zustimmen, wer ist dann noch berechtigt, darüber zu urteilen?
Macht und Kontrolle
Harry Chalmers ist einer der wachsenden Zahl von Philosoph*innen, die argumentieren, dass Monogamie an sich moralisch falsch sein könnte. In seinem 2019 im Journal of Value Inquiry veröffentlichten Aufsatz „Is Monogamy Morally Permissible?“ argumentiert er gegen eine Laissez-faire-Perspektive, die sowohl Monogamie als auch Nicht-Monogamie als angemessene Optionen ansieht. Stattdessen schreibt er: „Wir sollten Monogamie moralisch ablehnen.“ Um es klar zu sagen: Chalmers ist der Meinung, dass es den Menschen freistehen sollte, in einem bestimmten Zeitraum eine*n, und nur eine*n, Sexual- oder Liebespartner*in zu haben. Was er jedoch für falsch hält, ist die gängige Praxis, eine*r Partner*in als Bedingung für die Fortsetzung der Beziehung Beschränkungen in Bezug auf sexuelle Kontakte oder emotionale Intimität aufzuerlegen.
Dieses Argument wird nicht nur von Chalmers vorgebracht. Justin Clardy, der Philosoph der afroamerikanischen Polyamorie, den ich bereits zitiert habe, hat kürzlich ebenfalls gegen die moralische Zulässigkeit dessen argumentiert, was er „intimitätseinschränkende Zwänge“ nennt (sogar unter Polyamorist*innen). Diese sind definiert als „kategorische“ Einschränkungen für zusätzliche intime Beziehungen, ob sexuell oder „emotional“ – wie im Konzept des „emotionalen Fremdgehens“ – wenn man bereits in mindestens einer solchen Beziehung ist.
Der norwegische Philosoph Ole Martin Moen und sein Mitautor, der Krankenpfleger und Trans-Aktivist Aleksander Sørlie, weisen in einem Kapitel ihres demnächst erscheinenden Buchs in eine ähnliche Richtung.
Alle diese Autor*innen berufen sich auf ein Analogieargument, das sich auf den Fall von Freundschaften konzentriert. Stellen Sie sich Folgendes vor:
„Nehmen wir an, zwei Freund*innen, Jack und Jane, lesen beide gerne und treffen sich oft, um über Literatur zu diskutieren. Dann sagt Jack zu Jane, dass er glaubt, dass das Diskutieren über Literatur ‚ihr Ding‘ ist und dass er nur unter der Bedingung mit ihr befreundet bleiben wird, dass sie mit niemandem sonst über Literatur diskutiert – und dass diese Regel sogar an Tagen gilt, an denen Jack nicht in der Stadt ist, wenn er mit anderen Dingen beschäftigt ist oder wenn er einfach keine Lust hat, mit Jane abzuhängen oder zu reden.“
Das ist die Version des Arguments von Moen und Sørlie. „In diesem Fall“, so stellen sie fest, „scheint es klar zu sein, dass Jacks Anforderungen nicht in Ordnung sind; sie sind kontrollierend und einschränkend über das hinaus, was akzeptabel ist.“
Sagen wir, wir stimmen zu. „Wichtig ist“, so Moen und Sørlie weiter:
„Jack könnte diese Forderung nicht mit der Behauptung rechtfertigen, dass Jane eigentlich nur mit ihm über Literatur sprechen möchte. Der Grund dafür, dass diese Rechtfertigung nicht funktioniert, ist, dass die Anforderung überflüssig ist, sofern dies tatsächlich der Fall ist. Das Erfordernis ist nur insofern relevant und kommt nur dann zum Tragen, wenn Jane tatsächlich mit jemand anderem über Literatur diskutieren möchte; das Erfordernis dient dem Zweck, sie davon abzuhalten, dies zu tun. Aber wenn Exklusivitätsanforderungen im Falle von Freundschaften nicht in Ordnung sind, warum sind sie dann im Falle von romantischen Beziehungen in Ordnung?“
Nun, so werden Sie vielleicht denken, weil Freundschaften (und das Besprechen von Literatur) und romantische Beziehungen (und Sex) sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden, was einen anderen Standard rechtfertigt. Beispielsweise besteht beim Sex mit jemandem das Risiko einer Schwangerschaft und sexuell übertragbarer Infektionen, während bei der Diskussion über Literatur in der Regel kein Risiko besteht.
In ihren jeweiligen Schriften gehen Chalmers, Clardy, Moen und Sørlie auf diesen und andere zu erwartende Einwände ein und argumentieren, dass die behaupteten Unterschiede trotz des Anscheins keine moralisch relevante Unterscheidung darstellen – zumindest keine, die eine kategorische Einschränkung der außerfamiliären Intimität, sei sie nun körperlich oder emotional, zwischen Liebespartner*innen begründen kann.
Sie weisen beispielsweise darauf hin, dass bei vielen Formen der sexuellen Interaktion kein Schwangerschaftsrisiko besteht und dass das Risiko von Geschlechtskrankheiten gegebenenfalls durch Safer-Sex-Praktiken verringert werden kann. Sie weisen auch darauf hin, dass die angebliche „Besonderheit“ – d. h. der besondere Wert – einer romantischen Beziehung nicht dadurch geschmälert werden muss, dass man andere Beziehungen dieser Art hat: Jeder Mensch und damit jede Beziehung ist einzigartig.
Sicherlich, so sagen sie, mögen wir daran gewöhnt sein, sexuelle Intimität als etwas anzusehen, das sich grundlegend von anderen Formen der Intimität unterscheidet, z. B. von denen, die wir mit „platonischer“ Freundschaft assoziieren, aber kulturelle Konstruktionen lassen sich verlernen. Intimitäten verschiedener Art können wichtige Lebensgüter sein, und wir sollten wollen, dass unsere Partner, genau wie unsere Freunde, so frei wie möglich sind, das zu tun, was gut für sie ist.
Daraus ziehen sie den Schluss, dass es eine unzulässige Machtausübung ist, von einem Partner Monogamie zu verlangen, damit man ihm nicht seine Fürsorge und Zuneigung entzieht oder die ganze Beziehung aufgibt. Es ist kontrollierend.
Hier scheinen einige Dinge miteinander vermischt zu werden. Es ist eine Sache, in einer engen Beziehung zu leben, die nicht auf der Annahme von Monogamie beruht, und dann aus heiterem Himmel einseitig eine „Änderung der Regeln“ vorzunehmen. („Wenn du ab heute mit jemand anderem als mir sexuell intim wirst, beende ich diese Beziehung und breche die Verbindung ab.“) Obwohl Sie das Recht haben, eine Beziehung zu verlassen, die Sie nicht wollen – aus welchem Grund auch immer – würde ein solcher Schritt kein gutes Licht auf Ihren Charakter werfen.
Eine andere Sache ist es jedoch, von Anfang an klarzustellen, dass für Sie bei der Entscheidung, ob Sie in eine ernsthafte, enge Beziehung mit jemandem investieren wollen, ein gemeinsames Interesse an Monogamie wichtig ist. Du könntest sagen: „Hör mal, wenn du und ich diesen Wert nicht teilen, ist das völlig in Ordnung. Ich glaube nur nicht, dass wir am besten geeignet sind, um eine langfristige romantische Partnerschaft zu führen.“ Das scheint nicht unangemessen kontrollierend zu sein.
Die Bedeutung der Kommunikation
Doch wie Chalmers, Clardy und die anderen in ihrer Arbeit aufzeigen, glauben viele Menschen fälschlicherweise, dass sie Monogamie schätzen. Vielleicht beruht ihr Glaube auf fragwürdigen Annahmen über die Liebe: Zum Beispiel, dass sie eine begrenzte Ressource oder ein Nullsummenspiel ist. Oder vielleicht beruht die Überzeugung auf moralisch zweifelhaften Motiven, wie dem Wunsch, eine andere Person zu beanspruchen oder zu besitzen, um Unsicherheiten zu vermeiden. Oder vielleicht haben diejenigen, die glauben, dass sie Exklusivität schätzen, einfach nicht genug darüber nachgedacht.
Es besteht kein Zweifel daran, dass viele Menschen die Monogamie unreflektiert befürworten. Vielleicht tun das die meisten von uns. Aber es scheint weit hergeholt, anzunehmen, dass dies auf alle zutrifft. Nehmen wir also an, dass zumindest in einigen Fällen eine gut durchdachte, gegenseitige Vereinbarung zur Monogamie das Beste für ein Paar sein könnte. Auf der Grundlage ihrer jeweiligen Lebensgeschichte, Psychologie, Vorlieben, Werte und der zwischen ihnen herrschenden Dynamik kann es durchaus sein, dass die Chancen auf eine glückliche Beziehung am größten sind, wenn jeder von ihnen sich verpflichtet, sich an den metaphorischen Mast zu binden (und den anderen zur Verantwortung zu ziehen, während die Sirenen singen).
Keine der beiden Parteien ist verpflichtet, mit irgendjemandem „ernsthaft“ zu verkehren, schon gar nicht mit der anderen Person. Und es steht jedem frei, bestimmte Wünsche für die Art von Beziehung zu haben, in die er investieren möchte. Unter der Voraussetzung, dass sie die Dinge im Voraus besprechen und niemand den anderen zu einer Exklusivitätsvereinbarung drängt, wenn dies nicht das ist, was die andere Person wirklich will, ist es schwer zu erkennen, wie Monogamie als solche unmoralisch sein könnte.
Zugegebenermaßen werden monogame Vereinbarungen in der Regel nicht auf diese Weise angestrebt. Stattdessen geht ein*e Partner*in oft davon aus, dass der andere monogam sein will und sein wird, und wenn sich das nicht bewahrheitet, brechen Herzen. Eine explizite Kommunikation wäre eindeutig besser. Warum also scheitert sie so oft?
Kritiker*innen meinen, dass die schiere Macht und Verbreitung der Monogamie als gesellschaftliche Norm einer solchen Kommunikation entgegenwirken. Entweder wird Monogamie automatisch vorausgesetzt, so dass man gar nicht auf die Idee kommt, sie in Frage zu stellen, oder es besteht der Wunsch, nicht monogam zu sein, so dass man Gefahr läuft, von jemandem, der einem ans Herz gewachsen ist, abgelehnt oder sogar verunglimpft oder sozial stigmatisiert zu werden, wenn man diese Frage stellt.
In diesem Punkt haben die Kritiker*innen also Recht. Die Monogamie sollte nicht automatisch die Standardhaltung sein. Auf diese Weise wäre die Notwendigkeit der Kommunikation für jeden offensichtlich, da eine Präferenz für Monogamie nicht einfach vorausgesetzt werden kann.
Gleichzeitig sollte ethischen Alternativen zur Monogamie ein viel größerer Platz am Tisch eingeräumt werden. Die Gesellschaft sollte Beispiele für gut geführte nicht-monogame Beziehungen aufzeigen, damit die Menschen einen besseren Eindruck davon bekommen, wie sie funktionieren. Sie werden nicht für jede*n geeignet sein, aber für einige werden sie das Beste sein.
In ihrem rechtschaffenen Bemühen, die Monogamie von ihrem Sockel zu stoßen, gehen Chalmers und die anderen jedoch zu weit. Die gegenseitige Erwartung der Partner, dass keiner von ihnen eine romantische Beziehung mit einem anderen eingeht, ist nicht per se moralisch falsch.
Wie Bryan R. Weaver und Fiona Woollard in einem wichtigen Artikel in der Zeitschrift The Monist im Jahr 2008 argumentierten, gibt es gute und schlechte Gründe für Monogamie und Wege, sie auszuleben. Zu den schlechten Wegen gehören ungerechtfertigte Annahmen, unreflektierte Entscheidungen, Kontrolle, Besitzergreifung oder Manipulation. Die guten Wege beinhalten eine klare, offene Kommunikation, Respekt zwischen den Parteien und die Gleichberechtigung bei der Entscheidung, wie die Dinge laufen sollen.
Wir können und sollten uns gegen die schlechten Wege der Monogamie aussprechen, die derzeit vielleicht am häufigsten beschritten werden. Aber wir sollten sie nicht prinzipiell ausschließen und alle verurteilen, die jemals versuchen würden, sie zu verwirklichen. Wir sollten alle nachdenklicher, aufgeschlossener und kommunikativer sein. Und dann sollten wir sagen: Jedem das Seine.