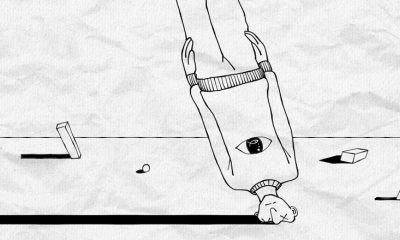Coronakrisen-Tagebuch
Leicht gesagt. Schwer gehört.
Bitte ein Pfund transparenter Mund-Nase-Schutzmasken. Das wünscht sich der Würzburger Frank Stößel in Zeiten der Pandemie.
Bitte ein Pfund transparenter Mund-Nase-Schutzmasken. Das wünscht sich der Würzburger Frank Stößel in Zeiten der Pandemie. Hier erklärt er uns, warum.

Frank Stößel fühlt sich als Hörgeräteträger in Corona-Zeiten gelegentlich „schachmatt“. Foto: privat
Wie könnte man die asymmetrische Kommunikation zwischen leicht und schwer hörenden Menschen in den Zeiten von Corona so darstellen, dass unser Gegenüber Verständnis aufbringt und Hilfe gewährt, wenn man sich mit Masken gegenüber steht und sich vorkommt, wie bestellt und nicht abgeholt? Wie könnte man den Mitmenschen klar machen, wie schwer man nicht nur hört, sondern wie schlecht man versteht, wenn das Gegenüber hinter einer Corona-Gesichtsmaske dies und das so leicht daher sagt, als lebten wir noch so unbeschwert wie in den Zeiten vor Corona?
Nach dem Traum von heute Nacht komme ich mir in diesem Dilemma von Nähe und Abstand noch hilfloser vor. Der Traum führte mir einen gestiefelten Kater mit durchsichtiger Nase-Mund-Maske im Brombeerstrauch vor. Inmitten eines Gewirrs schlangenartiger Kabel und stacheliger Stecker jonglierte er auf seinen Hinterpfoten stehend mit zwei dampfenden Kartoffeln. Um den Kater herum waren Mikrofone, Lautsprecher, Fernseher, Radios, Laptops und Telefone kreuz und quer miteinander verstöpselt. All das schien den Jongleur nicht zu stören. Er genoss offensichtlich coole Musik mit kabellosen Ohrhörern und ließ dazu seine Hüften locker kreisen.
Komisch war, dass der tanzende Kater Gesichtszüge meines vor Jahrzehnten verstorbenen Maler-Opas trug. Was wollte mir Opa nur sagen? So gut wie dem Kater in meinem Traum ist es ihm zu seinen Lebzeiten als fast tauber Mensch eben nicht gegangen. Was gab es denn schon zwischen 1900 und den 1960er Jahren für Schwerhörige an Hörhilfen, um leicht Gesagtes nicht so schwer zu verstehen?
Ich konnte damals noch das Gras wachsen hören
Armer Opa, durchfuhr es mich in Erinnerung an meinen schwerhörigen Großvater. Doch da leuchteten auch schon bunte Bilder aus meiner Kindheit auf. Während unserer gemeinsamen Einkäufe bei Hofmann am Dominikanerplatz, wo Opa Farben und Pinsel für sein Hobby, die Malerei, kaufte, bei Schum am Schmalzmarkt und bei Deppisch am Marktplatz, wo er Werkzeuge, Schrauben, Nägel und Praktisches für den Haushalt seiner Tochter, meiner Mama, erwarb, kam mir Opa gar nicht so arm vor, er hatte ja mich. Als Knirps mit 11 Jahren fungierte ich nämlich als sein Adjutant und Übersetzer, und ich glaube, auch er war ganz glücklich, wenn wir beide zusammen in die Stadt gingen. Da wurden nicht nur Einkäufe erledigt, das waren unvergessliche Erlebnisse für mich.
Ich konnte damals noch das Gras wachsen hören, während Opa leicht Gesagtes nur sehr schwer hörte und schon gar nicht immer verstand, es sei denn, man sprach so laut man konnte direkt in sein „gutes“ Ohr. Dabei formte man die Hände zu einer Muschel, gerade so praktisch wie ein Bakelit-Schalltrichter, in welchen ich dann sprach, wenn wir zuhause waren. Wenn wir das Hörrohr einsetzten, gelangten meine Worte durch einen längeren Schlauch zwischen Schalltrichter und Opas Ohr, auf der rechten Seite hatte er ja zum Glück noch kleine Hörreste.
Opa war wegen einer Granatexplosion im Ersten Weltkrieg auf dem linken Ohr ganz taub geworden. Auf dem anderen Ohr war er schon vor dem Krieg schwerhörig. Das schwere Hören war für ihn später als Postinspektor ein großes Handikap. Anfangs half ihm noch lautes Sprechen seines Gegenübers von Angesicht zu Angesicht. Dabei war das Ablesen vom Mund eine große Hilfe. Bald half aber nur noch lautes Sprechen direkt ins rechte Ohr über den mit beiden Händen geformten Trichter oder in besagtes Hörrohr, welches Opa außerhalb des Hauses nicht so gerne benutzte. Es war einfach nicht so praktisch zu handhaben wegen seiner enormen Ausmaße.
Zum Glück gab es die Zaubertafel
An Theken und an Schaltern mit lauter Geräuschkulisse war Opa bei Nachfragen seines Gegenübers aufgeschmissen oder beinahe Schachmatt, wie er das ungute Gefühl bei erschwerten Gesprächen als Schachspieler gerne bezeichnete. In solchen Fällen leistete seine postkartengroße Schreibtafel mit Griffel gute Dienste. Wie ein Zauberer zog er sie dann aus seiner Weste.
Man schrieb seine Frage oder seine Antwort darauf und gab die Schreibtafel an ihn zurück. So konnte das hin und her gehen, denn Opa unterhielt sich trotz seiner Hörbehinderung noch leidenschaftlich gerne mit den Menschen. Nachdem er verstanden hatte, schob man die Seele der Tafel, welche mit einer dünnen Wachsschicht überzogen war, aus dem Rahmen heraus und schob sie sogleich wieder hinein, und schon war die Tafel eine tabula rasa, wie Opa diese Zauberei erklärte, und somit frei für neue Botschaften. „Als Einjähriger hatte ich am Gymnasium auch Latein, mein Junge. rasa kommt von radere und bedeutet schaben. tabula ist die Tafel, wie du schon weißt. Römische Wachstafeln glättete man einfach durch Abschaben der Schrift mit einer Spatel.“
War die Verständigung in einem Geschäft sehr schwierig, bat Opa die Verkäuferin, ihre Nachfragen und Erklärungen auf die Zaubertafel zu schreiben. Auch die Verkäufer hatten ihren Spaß an dem irdischen Wunder. So geschah es nach den Einkäufen bei Hoffmann und Nachfolger, Schum und Deppisch auch im Käsegeschäft Nussbaumer in der Martinsgasse. „Wie viel von dem Schweizer Käse soll es denn sein?“ stand dann zum Beispiel auf der Zaubertafel zu lesen. Als Antwort deklamierte Opa mit sonorer Stimme in seinem Stettiner Singsang, in welchem ich die Wellen der Ostsee rauschen hörte, um die sich viele von Opas Frühstückstories rankten: „Bitte, ein halbes Pfund Käseaufschnitt, vier Brötchen, und zwei Becher Buttermilch!“
Die Leute im Laden drehten sich nach uns um und staunten, was der stattliche ältere Herr da von sich gab. Weck bezeichnete er ungeniert nach pommerscher Art als Brötchen, irgendwie komisch, während ich an seiner Seite aus Scham vor den Blicken der Einheimischen zu schrumpfen schien. Ich durfte mit dem Geld aus Opas Portemonnaie bezahlen und nachzählen, ob das Restgeld stimmte. Anschließend setzten wir uns in einer Fensternische zur Brotzeit nieder.
Seit Corona bin auch ich gelegentlich schachmatt
Opa öffnete sein Stettiner Taschenmesser, bei dessen Anblick meine Augen groß wie Kirschen wurden, schnitt zwei Brötchen auf, belegte eines mit dem frischen Käse und eines mit Wurst, welche wir zuvor beim Metzger Am Schönen Eck mit ähnlicher Dramaturgie wie im Käsegeschäft eingekauft hatten, und überreichte mir beide Schrippen, wie er die Brötchen schmunzelnd nannte: „Nun iss` man schön mein Junge!“ Er selbst aber aß nichts. Das hätte ihn nur abgelenkt von seiner Freude darüber, dass er dem dünnen Hering, als den man mich zuhause gerne aufzog, etwas Ordentliches auf die Rippen gab. Die frische Buttermilch tranken wir in kräftigen Zügen, nachdem wir mit den Bechern wie zwei alte Stammtischbrüder angestoßen hatten: „Denn man Prost mein Junge!“ „Prost Opa, und danke!“
An diese Stadtgänge mit Opa muss ich in der letzten Zeit öfter denken, wenn ich nun 65 Jahre später als Hörgeräteträger beim Einkaufen so manches Mal meine Probleme beim gegenseitigen Verstehen habe, weil ich trotz technisch ausgeklügelter Im-Ohr-Hörgeräte mein Gegenüber kaum verstehe. Trug die Verkäuferin eine sichtdichte Nasen-Mund-Maske wie jüngst in der Bäckerei, dann war ich „Schachmatt!“ wie Opa damals und versuchte die Wende im Gespräch zu meinen Gunsten: „Ich kann Sie schon kaum verstehen wegen Ihrer Gesichtsmaske.
Wenn Sie mir noch den Rücken zukehren, während sie den Käse aufschneiden, und mich dabei etwas fragen, dann verstehe ich überhaupt nichts mehr.“ „Ich kann Sie auch ganz schlecht verstehen mit Ihrer Maske, weil ich Ihren Mund nicht sehen kann, was sagten Sie noch?“, konterte die Verkäuferin mit einem verschmitzten Lächeln um ihre Augen. Da mussten wir beide herzhaft lachen. Beinahe hätten wir unsere Masken gleichzeitig herunter gerissen, unsere Mundbilder in Ergänzung zu unseren sprechenden Augen frei gegeben, um unserem Lachen freien Lauf zu lassen, ließen das aber mit „Gib Corona keine Chance!“ wie aus einem Munde.
Im Bus nach Zell dachte ich noch einmal darüber nach, was Opa mir im Traum mit seiner durchsichtigen Maske, dem Kabelwirrwarr und den Bluetooth-Ohrhörern sagen wollte. Ach ja, ich habe doch zuhause dieses kleine Mikrofon, welches sich mein Gegenüber ans Hemd oder die Bluse klemmen kann. Es hat eine Verbindung zu einem Transmitter, der die Stimme meines Gegenübers an meine Hörgeräte im Ohr weiterleitet, so dass ich alles verstehen könnte. Wie leicht Gesagtes gemeint ist, kann ich die Mimik meines Gegenübers mit Maske nicht lesen, also wäre das Mikrofon auch keine wirkliche Hilfe. Ich kann doch nicht jedes Mal einer Verkäuferin das Mini-Mikrofon anbieten, bevor wir unser Gespräch beginnen; das geht auch schon wegen der Hygieneregeln gar nicht.
Danke, Opa
Wie wäre es dann mit der Zaubertafel? Sogleich googelte ich Zauberschreibtafeln, und siehe da, was gab es für eine Riesenauswahl an digitalen Schreibtafeln. Die Tafel müsste jedes Mal vor und nach Gebrauch desinfiziert werden, zu viel Aufwand. Wenn mein Gegenüber ein Smartphone mit Whatsapp hätte? Dann könnten wir beim Abstand von eineinhalb Metern uns über Video verständigen wie im Home-Office. Da sah ich eine Verkäuferin vor mir, wie sie mir einen Vogel zeigt „Wegen ein paar Brötchen über den Tresen hinweg whatsappen, so ein Quatsch!“
Dann kam mir wieder Opa als gestiefelter Kater mit durchsichtiger Nasen-Mund-Maske in den Sinn. Ob es schon transparente Masken gibt? Kaum gegoogelt, erwies sich die transparente Gesichtsmaske als längst diversifiziertes Produkt mit zig Einträgen. Transparenz wäre in der Tat eine gute Lösung. Allerdings müsste ich für meine Gesprächspartner in Arztpraxen, Apotheken und anderen Geschäften jeweils durchsichtige Gesichtsmasken parat haben. Wegen der Hygieneregeln müsste ich sie ihnen überlassen, ok. Schenkte ich sie ihnen, würden sie sie auch für mich anlegen? Einen Versuch wäre es wert. „Danke Opa, für dein Erscheinen in meinem Corona-Masken-Traum. Du hast mir sehr geholfen, aus dem Brombeerstrauch der Kommunikation zwischen „Leicht gesagt und schwer gehört“ herauszufinden. Und die Sache mit der Bluetooth-Verbindung anstatt des ollen Kabel- und Steckersalats zwischen Smartphone, Radio, Fernsehen und mir ist auch eine glänzende Idee.
Gleich nach dem Frühstück habe ich ein Bluetooth-Radio mit CD-Player mit den dazu passenden Bluetooth-Ohrhörern bestellt. Beides kam zwei Tage später schon bei mir an. Das Wundergerät war gleich aufgestellt und im Gedenken an meinen Opa war die CD mit Beethovens Fünfter eingelegt. Endlich wieder alles aus unserer LP- und CD-Sammlung von pianissimo bis fortissimo voluminös hören zu können wie im Konzertsaal, ohne dass dabei meiner leicht hörenden besseren Hälfte die Ohren abfallen, weil wir auf getrennten Kanälen hörten, war ein Gedicht. Ich war platt, nicht vom schweren Hören, sondern vom leichten Hören der gewaltigen Musik. Beseelt von diesem Glück bestellte ich im Netz gleich noch ein „Pfund“ transparente Gesichtsmasken, dann könnten mein Gegenüber und ich zum Beispiel im Cafe auch wieder in unseren Gesichtern lesen, was unsere Münder so alles sprechen.