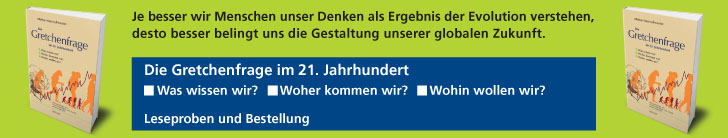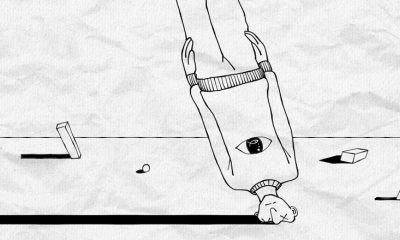Coronakrisen-Tagebuch
Die unnormale Normalität. Wohin kehren wir zurück?
Wenn ich damit hadere, mir einen Reim auf die Normalität vor und nach Corona zu machen, klopfe ich bei Goethe an.
Von Martin A. Völker
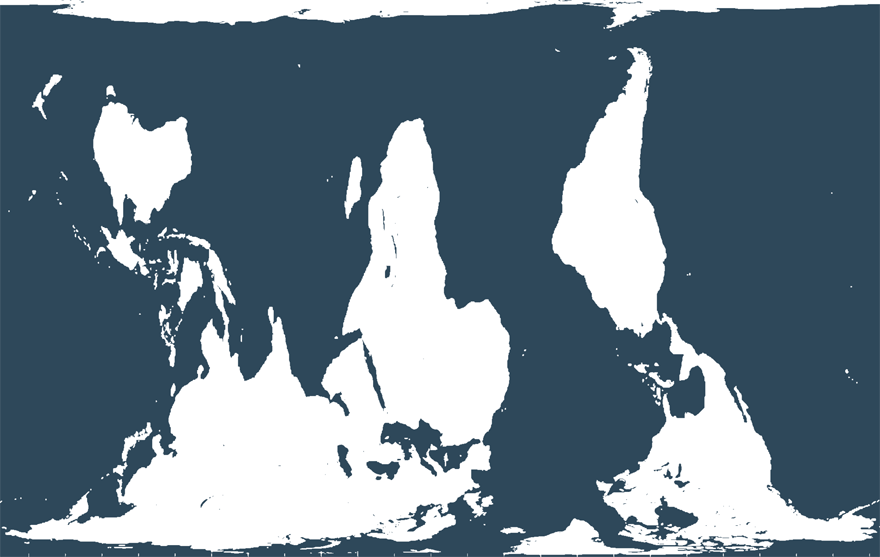
Dort, wo der Höhepunkt der Corona-Pandemie erreicht und überschritten zu sein scheint, beginnt man die das öffentliche Leben stillstellenden Maßnahmen zu lockern. Ermöglicht wird damit die Rückkehr zur Normalität. Aber da momentan wenig so ist, wie es vor kurzer Zeit noch war, wird die anvisierte Normalität eine andere sein. Der angemessene Sprachgebrauch ist hier noch etwas unklar. Wird es sich um eine restriktive Normalität handeln oder um einen semi-normalen Zustand mit gewissen Einschränkungen oder gar um eine Verstetigung der Unnormalität mit spontan geöffneten Zeitfenstern einer schon heute halb vergessenen Liberalität? Jede sprachliche Nuance hat letztlich erhebliche Auswirkungen auf unsere Vorstellungen vom gesellschaftlichen Zusammenleben und vom Menschen überhaupt, auf die kulturelle und politische Teilhabe. Das geflügelte Wort „leben und leben lassen“ bekommt mit einem Mal den Beiklang eines drohenden Missverhältnisses zwischen Selbst- und Fremdbestimmung.
Die Frage, was normal ist, hat eine lange Geschichte. Sie treibt den Menschen um, seitdem er angefangen hat, selbstständig zu denken und sich in sozialen und politischen Gefügen wahrzunehmen. Wer nach Normalität fragt, der setzt sich zu anderen ins Verhältnis und versucht eine Bestimmung dessen, was zuträglich und zulässig sein kann und was nicht. Die fragende Suche nach Normalität wird nicht selten begleitet von anderen, kaum leichteren Begriffsklärungen. Der Philosoph Wilhelm Windelband gibt in seinen Präludien (1911) der Meinung Ausdruck, dass Wahrheit die Normalität des Denkens sei. Welche Schlüsse lassen sich daraus mit Blick auf unsere Zeit ziehen, in der mitunter unerkennbar gefakte Wahrheiten durch die Netze geistern? Wie normal war unsere Normalität also vor Corona? Lohnt es sich, zu dieser Normalität zurückzukehren? Müssen wir in der Krise neue Ziele definieren, die zusammengenommen unsere künftige Normalität ausmachen sollen?
Wenn ich mir ansehe, was gemeinhin als normal gilt, so erkenne ich, dass Normalität viel aushält und hinnimmt, dass sie im positiven Sinne flexibel und dynamisch ist, dass Normalität aber ebenso mit Wegschauen und Ignoranz einhergeht. Was kümmert mich normalerweise die Normalität meiner Nebenmenschen? Die werden schon wissen, was für sie das Normale ist. In deren gute Normalität mische ich mich nicht ein, weil ich genauso wenig in meiner Normalität gestört werden will. Zu hinterfragen wäre hier allerdings, in welchem Verhältnis Normalität und Verantwortung stehen können und müssen, ob die eigene Normalität nicht häufig bloß das verhüllende Gewand einer rücksichtslosen Individualität darstellt.
Meine, deine, unsere Normalität
Wenn ich damit hadere, mir einen Reim auf die Normalität vor und nach Corona zu machen, klopfe ich bei Goethe an. Wer kann heute schon von sich behaupten, mit Dichtung, Wissenschaft und Politik gleichermaßen vertraut zu sein? In seinen Nacharbeiten und Sammlungen zur Morphologie bestimmte Goethe das, was normal ist. Die Natur gestalte normal, wenn sie den Einzelheiten die Regel gebe, so Goethe. Abnorm sei dagegen, wenn die Einzelheiten in Willkür dominierten.
Was in dieser Formulierung nach hartem Gesetz, nach historisch überwundener Autorität und Illiberalität klingt, erhält bei Goethe jedoch eine nachdenkenswerte Pointe. Bei ihm ist die Natur geprägt durch einen steten Wechsel zwischen Bildung und Umbildung. Auf dieser Basis scheine das Abnorme normal und das Normale abnorm zu werden. Und manchmal sei es wie bei den ins Auge fallenden Blumen, dass nämlich die Natur jene Grenze, die sie sich selbst gesetzt habe, überschreite. Dabei entstehe eine als schön empfundene „andere Vollkommenheit“.
Von Goethe lernen könnte demnach bedeuten, unseren gehabten Zustand von Normalität genauer zu beschreiben. Was hat dessen Vollkommenheit ausgemacht? Welche Unvollkommenheiten lassen sich erkennen, sind tolerabel, sind zu überwinden? Wieviel Mut braucht eine andere, bessere Normalität? Wenn wir Goethe folgen, kommen wir auch dahinter, dass das Streben nach Vollkommenheit etwas mit sinnlichem Genuss und dem zerstörungsfreien Austausch zwischen Mensch und Natur zu tun hat und weniger oder nichts mit Selbstoptimierung.